BR01
BR23
BR24
BR38
BR44
BR50
BR52
BR56
BR64
BR80
BR81
BR86
BR89
BR92
BR94
Diesel
V23
V36
V60
V75
V100
BR130
V180
V200 DB
V200 DR
My
Triebwagen
VT 2.09./BR171
VT137
Persenenwagen
Ci pr93
Ci30
C3 pr11
Rekowagen
Doppelstock
Y-Wagen
ABm
Pwgs-56
Güterwagen
0mu
Kmm
Bromberg
BTmm
Kesselwagen
geschlossene Wagen
Dampflokomotiven
BR01
01 114
01 120
01 502


Diese Baureihe ist wohl die populärste deutsche Dampflok und galt bis zu
ihrem Ausscheiden aus dem Plandienst als das Paradepferd der Bahn. Es
wurden zwischen 1926 und 1938 231 Maschine gebaut. Als erste deutsche
Einheitslokomotive war sie für den Einsatz im Schnellzug- und
Eilzugdienst vorgesehen versah diesen über einen langen Zeitraum fast im
gesamten deutschen Raum, bei der Deutschen Reichsbahn teils noch bis in
die achtziger Jahre. Diese, im original bis 130 km/h schnelle,
Dampflokomotive wird unter anderem von Tillig in fünf Varianten
vertrieben.
Ich besitze eine Lokomotive mit der Nummer 114. Eine Lokomotive mit der Nummer 120 ist geplant.
BR23
23 002
23 1111
23 1023


Die Dampflokomotive der BR23.10 hat ihren Ursprung in der
Reichsbahnentwicklung der BR23, die 1941 mit zwei Vorauslokomotiven
geliefert wurde. Kriegsbedingt unterblieb die Serienproduktion der als
Ersatz für die BR 38 gedachte Baureihe. Nach dem Krieg griff 1954 die DR,
in deren Besitz die zwei Loks der BR23 gelangten, die
Konstruktionsentwürfe wieder auf. Entsprechend dem damaligen
Entwicklungsstand wurde jedoch ein geschweißter Kessel mit Verbrennungskammer
und eine Mischvorwärmanlage vorgesehen.
Die ersten zwei Baumusterloks wurden 1957 geliefert. Nach technischen
Änderungen erfolgte in folgenden zwei Jahren die Serienfertigung von 111
Stück. Damit ist die BR 23.10 die letzte in Serie gebaute Neubaudampflok
der DR. Die Maschinen bewährten sich im Einsatz sehr gut. Durch die
geringe Achsfahrmasse waren sie auch für Nebenstrecken tauglich. Die gute
Dampfentwicklung des Kessels und das gute Beschleunigungsvermögen ließ
auch den Einsatz vor Schnellzügen und leichteren Güterzügen zu. Mit der
Einführung des EDV-Nummernsystems erhielten die Loks die
Baureihenbezeichnung 35. Die letzten Planeinsätze erfolgten 1981 von
Nossen aus. Dort ist auch die letzte gebaute Lok, die 35 1113 abgestellt.
Von diesem Loktyp besitze ich zwei Modelle. Sie haben die Loknummern 1111 und 1023.
BR24
24 004
Die BR 24 gehörte zu den Einheitslokomotiven und ist von 1928 bis 1940 mit einer Stückzahl von 95 Maschinen gebaut worden. Sie wurde für den schnellen Personenverkehr auf Nebenbahnen konzipiert und stimmte in vielen Baugruppen mit der BR 64 überein. Durch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h konnte die Lokomotive im Nebenbahn- als auch im Hauptbahnverkehr eingesetzt werden.
BR38
38 3518
Für die gestiegenen Anforderungen im Personenzug- und
Schnellzugverkehr entwickelte die "Preußische Staatsbahn" (K.P.E.V) die
Personenzuglokomotive der Gattung P8. Die ersten Exemplare dieser
Dampflokbaureihe wurden im Jahre 1906 in Dienst gestellt. Nach und nach
wurde die Konstruktion verbessert und von „Kinderkrankheiten" befreit.
Nach Übernahme der Länderbahnen in die damalige Deutsche Reichsbahn, wurde
dieser Loktyp zur Baureihe 38 umbenannt.
Bis zum Jahre 1924 wurden insgesamt 3.561 Stück dieses Typs für deutsche
Eisenbahnen gebaut.
Aber auch im Ausland erweckte diese Maschine großes auf Interesse. Rechnet
man die Exemplare, die ins Ausland verkauft wurden hinzu, so wurden vom
Typ P8 bzw BR 38 insgesamt 3.948 Stück gebaut. Damit war sie die am
meisten gefertigte Personenzuglokomotive Europas.
Entsprechend dieser großen Anzahl wurden die Lokomotiven nach
Zusammenschluss der Länderbahnverwaltungen zur Deutschen Reichsbahn - ab
Mitte der 1920iger Jahre - in ganz Deutschland eingesetzt. Sie entwickelte
sich zur wichtigsten Dampflokbaureihe für den Personenzugverkehr. Aber
auch leichte Güter- und Schnellzüge wurden von ihr befördert.
Lokomotivführer lobten ihre Robustheit und Zuverlässigkeit, so dass die
Maschinen gerne als „Mädchen für alles" herangezogen wurde und neben
Personenzügen auch planmäßig Schnellzüge, sowie gelegentlich Güterzüge
beförderten.
Zu den Eilzugwagen des ersten Neubauprogramms der Deutschen Bundesbahn
zählten die sog. „Mitteleinstiegswagen„ mit der neuen Standard-Länge von
26,4 m. Sie waren für den Bezirksverkehr, sowie für den Fernverkehr über
mittlere Entfernungen vorgesehen. Um die Bahnhofsaufenthalte verkürzen zu
können, verfügten die Wagen über 4 Türen pro Seite. Ein schnelles Ein- und
Aussteigen - besonders im Berufsverkehr - wurde dadurch ermöglicht.
Passend zu diesen Wagen wurde ein Steuerwagen für Wendezüge entwickelt.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Wagen betrug 120 km/h.
BR44
44 1040
Schwere Güterzuglokomotive mit Schlepptender BR 44 der Deutschen Reichsbahn (DR). Achsfolge 1’E h3. Betriebszustand: 1970er Jahre. Einsatz: schwere Güterzüge.Modell: Komplette Neukonstruktion. Detaillierte Ausführung mit Witte-Windleitblechen und Kohletender. Mit 3-Licht Spitzensignal. LED-Beleuchtung. LüP 190 mm. Die nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der DR verbliebenen Lokomotiven der BR 44 bildeten auch dort das Rückgrad des schweren Güterzugdienstes. Da viele Lokomotiven wegen Materialersparnis im Krieg ihre Windleitbleche eingebüßt hatten, rüstete die DR die Maschinen mit den kleineren Blechen der Bauart Witte aus, die recht weit oben am Kessel angesetzt waren und den Maschinen ein charakteristisches Erscheinungsbild verliehen.
BR50
50 3624



Die Lokomotiven der Baureihe 50 waren für beide deutsche Bahnverwaltungen
im Zeitalter der Dampftraktion eine wichtige Lokomotive. Mit ihrer
geringen Achsfahrmasse konnte sie auf allen Strecken eingesetzt werden.
Die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h machte sie für beschleunigte
Güterzüge genauso geeignet wie für Personen- oder Eilzüge. Im Auftrag der
deutschen Rüstung für den Zweiten Weltkrieg in ganz Europa gebaut, hat sie
auch eine solche Verbreitung gefunden. Auch nach dem Krieg wurden noch
einige Loks für europäische Bahnen gebaut. Beim Personal war sie wegen
ihres geräumigen Führerhauses und ihrer Zuverlässigkeit beliebt. Auch die
Werkstätten hatten wenig Probleme mit ihr. Für die DR wurde sie neben der
BR52 zu einer der wichtigesten Dampflok. Bedingt durch den Zweiten
Weltkreig wurde die Produktion der BR50 forciert und es entstanden über
drei tausend Lokomotiven dieser Baureihe. Davon gingen aber nur 350 Stück
zur Reichsbahn. Da die alten Kessel aber nicht alterungsbeständig war,
wurden 208 Maschinen mit geschweißten Kesseln der Baureihe 23.10
ausgestattet.
Die Firma Tillig aus Sebnitz stellt dieses Modell her. Art.-Nr.: 02290
BR52
52 3232




Nur Wenige Jahre sollte die Baureihe fahren. Dann glaubten die
Diktatoren, den Zweiten Weltkrieg gewonnen zu haben und die Loks ersetzen
zu können. Deren Konstruktion basiert auf der Baureihe 50, die seit
Kriegsbeginn in immer stärker vereinfachter Form entstand. So entstand
1942 die erste Baumusterlok der BR 52. Bei der 52 entfielen 1000 Einzel-
und Ausrüstungsteile und 3000 von den verbleibenden 5000 Teilen wurden
vereinfach. Von über 2 Tonnen Buntmetall wurden bei der 52 nur noch 150
Kilogramm benötigt. Dadurch konnte der Gesamtaufwand des Materiales von
165 t auf 139 t gesenkt werden. Trotzdem konnte eine
Frostschutzeinrichtung verbaut werden, welche den russischen Winter
trotzen sollte. Des Weiteren konnten etwa 6000 Arbeitsstunden eingespart
werden.
Wie viele Lokomotiven genau die Werkhallen verließen, ist nicht genau
bekannt. Unterschiedlichen Quellen zufolge sind es zwischen ca. 6100 und
6250 produzierte Einheiten. Die Bundesbahn fertigte aus lagernden Teilen
noch 86 Maschine und musterte alle 52'ger Maschinen bis 1963 aus, bei der
Reichsbahn verschwanden sie in den Achtzigern aus dem Streckendienst. Sie
dienten noch bis in die neunziger Jahre als selbstfahrende
Weichenheizanlagen.
Bei dem oben abgebildeten Modell handelt es sich um eines der Firma Tillig (02270).
BR56
56 2719

56 2189
56 2138
56 2013
Die BR 56 20-29 entstand aus der Vereinfachung der G 8.3. Diese Lokomotive
wurde noch von der Preußischen Staatsbahn 1919 unter der Bezeichnung G
8.2 in Betrieb genommen. Auf Grund ihrer hohen Masse und dem großen
Reibungsgewicht war sie einer der stärksten deutschen
Güterzuglokomotiven. Die Lok bewährte sich sehr gut und wegen der
gegenüber den Drillingsmaschinen G 12 und G 8.3 einfacheren Unterhaltung
wurde die Lok auch noch von der DRG bis 1928 beschafft. Die Loks dieser
Baureihe wurden auch mit in die Versuche der STUG (Studiengesellschaft zur
Einführung der Kohlenstaubfeuerung) einbezogen. Die Lokomotive wurde für
den Nahgüterverkehr auf Hauptbahnen, als schwere Vorschublok und wegen
der guten Anfahrbeschleunigung auch vor Personenzüge eingesetzt. Wegen
der hohen Achslast von 17 t war sie nicht für Nebenbahnen geeignet. Nach
dem Krieg waren die noch bei beiden deutschen Bahnverwaltungen im Einsatz.
Die DR schrieb auch noch an einige Loks die EDV-Nummern an. Anfang der
siebziger Jahre schieden die Loks aus. Die in Sebnitz ansässige Firma
Tillig fertigte dieses Modell in vier Varianten. Eine Neuauflage ist bereits erschienen.
Wenn jemand Detailzeichnungen oder Bilder hat und sie mir zusendet, wäre ich sehr erfreut.
Zur Zeit sind erst fünf Lokomotiven vorhanden, aber ein paar sollen noch dazu kommen. Sie werden zu den oben erwähnten Nummern umgeschrieben. Einige werden aber zur Baureihe 55.25 umgebaut.
BR64
64 001
BR80
80 022
80 023
BR81
81 001
81 004

Die Baureihe 81 ist als schwere Vorschublok von Hanomag 1927 an die DRG
geliefert worden. Mit einer Achsfahrmasse von 17.5 t lag sie zwischen der
der Nebenbahn und der von Hauptbahnen, da zum Zeitpunkt des Erscheinens
die meisten Rangierbahnhöfe noch nicht auf 20 t ausgebaut waren. In enger
Anlehnung an die BR 80 entstand diese um rund einen Meter längere Lok.
Die meisten Bauteile waren mit der BR80 identisch. Als Rangierlok reichte
eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aus. Ein 1939 begonnener Bau
weiterer Loks wurde kriegsbedingt abgebrochen.
Ich besitze die beiden oben aufgeführten Lokomotiven.
BR86
86 460

86 323


86 210
86 106
86 460
Die BR 86 war bereits im ersten Typisierungsplan der DRG
1924 enthalten. Sie war mit 15 t Achsfahrmasse eine Nebenbahnmaschine und
zur Beförderung schwerer Güterzüge auf Strecken mit leichter
Steigung und Personenzügen auf stärkerer Steigung vorgesehen. Die ersten
Loks wurden 1929ausgeliefert, die letzten Loks wurden 1943 gebaut. Nach
Einbau von Krauss-Helmholtz-Lenkgestellen statt der bis dahin verwendeten
Bisselachsen und zusätzlichen Laufradbremsen konnte die
Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf 80 km/h heraufgesetzt werden. Diese
Loktype wurde auch an private Eisenbahngesellschaften geliefert. Die im
Krieg gebauten Loks wurden als ÜK Maschinen gefertigt. Dabei wurde
weitgehend die Schweißtechnik angewandt und viele Bauteile vereinfacht
oder werggelassen. Nach dem Krieg waren die Loks bei der PKP, CSD, SZD,
der ÖBB und bei den beiden deutschen Bahnverwaltungen zahlreich
vertreten. Die DB musterte di BR 86 zu Beginn der siebziger Jahre aus. Die
DR rüstete die auf der Insel Usedom fahrenden Lokomotiven mit
Witte-Windleitblechen aus. Mitte der achtziger Jahre musterte die DR die
letzten Loks dieser Baureihe aus.
Die Firma Tillig fertigte das Modell des DDR-Vorgängers Berliner TT Bahnen/Zeuke bis Ende der neunziger Jahre. Glaube ich jedenfalls. Nach den neuesten Meldungen soll wohl ein komplett neues Modell erscheinen.
BR89
89 001

Bei der C-gekuppelten Rangierlokomotive für Strecken mit leichten Oberbau,
der nur 15 t Achslast zuließ, kehrte die Reichsbahn nochmals kurz zum
Nassdampf zurück. Zu Vergleichszwecken ließ die Reichsbahn je drei
Maschinen mit Nass- und Heißdampftriebwerk ausrüsten. Die Messfahrten
bewiesen, dass es sinnvoll war, auch Rangierloks mit Heißdampf fahren zu
lassen. Allein der Kohleverbrauch war um 18% niedriger. Fünf Lokomotiven
gelangten nach dem Krieg nach Polen, die anderen fünf kamen zur DR. Die
Reichsbahn gab davon drei ab, die letzte diente bis 1968 beim Raw Dresden.
Dies ist eine Rokal-Modell und habe dazu keine weiteren Informationen.
BR92
92 6582
92 6513

In die Baureihe 92 ordnete die Deutsche Reichsbahn Tenderlokomotiven der
Achsfolge D ein, die sie von Privatbahnen übernahm. Schon vorher hatte
die DRG in diese Nummer D-Kuppler der Länderbahnen eingeordnet. Das
Spektrum der Lokomotiven ist also breit. Eine der abgebildeten
Modelle stammte von 1927 und ist an die
Weimar-Berka-Blankenhainer-Eisenbahn von Orenstein & Koppel geliefert
worden. 1949 gelangte 92 6582 in den Fuhrpark der DR. Die Lok hat fast ihr
ganzes Leben auf dieser Strecke zugebracht. Sie ist als Streckenlokomotive
eingesetzt gewesen und war gegen Ende ihrer Dienstzeit als Rangierlok im
Bahnhof Weimar mit nachgerüsteten Rangierfunk im Einsatz. Sie wurde 1965
ausgemustert und 1968 verschrottet. Wo 92 6513 eingesetzt wurde und ob sie
überhaupt gegen hat, weis ich nicht. Dies sind meine einzigen Lokomotiven
der Baureihe 92.65 und schon sehr lange in Familienbesitz.
BR94
94 2004
94 2087

Die oben abgebildeten Modell sind keine echten 94'er. Sie wurden aus
jeweils zwei 92'er zusammengebaut und um eine Achse erweitert. Ersteigert
bei EBay.
Diesellokomotiven
V23 oder T334
V23 023
Werklok Nr 4


Die dieselhydraulische Rangierlok T 334 wurde vom tschechischen
Schwermaschinenbau-Kombinat ČKD
Prag gebaut. Diese 350 PS starke Lok wurde Anfang der sechziger Jahre auch
von chemischen Betrieben der DDR gekauft, ebenso von Nebenbahnen mit der
Baureihenbezeichnung V23. Dabei blieb am Führerhaus die ursprüngliche
Reihenbezeichnung der ČSD
bestehen und wurde nur durch die Angaben des Betreibers, z.B. Werklok Nr.
4 des Chemiekombinates Schwarza, ergänzt.
Bei mir ist die alt Lok lediglich nur als Streckenversuchslokomotive eingesetzt.
V36
V36 071
V36 021

Die Lokomotiven der Baureihe V36 (Achsfolge C) wurden im 2. Weltkrieg im
Auftrage der Deutschen Wehrmacht entwickelt und gebaut. Sie liefen unter
der Bezeichnung WR 360 C 14. Diese dieselhydraulischen Lokomotiven waren
für Verschubdienste in den Rüstungsbetrieben und für den Transport von
Eisenbahngeschützen vorgesehen. Die Maschinen erwiesen sich bald einigen
der noch vorhandenen Dampflokomotiven ebenbürtig und wurden nach
Kriegsende neben Rangier- und Übergabediensten auch im Güter- und
Personenzugverkehr auf Nebenstrecken eingesetzt.
Die V36 kann somit als die erste in Serie gefertigte Diesellok für den Streckendienst angesehen werden. Wurden zwei Loks mit den Führerständen aneinander gekuppelt, so ließ sich von einer Lok die Zweite mitsteuern. Die maximal 60 km/h schnellen Maschinen wurden von der DB noch nach dem Krieg nachgebaut. Einige Loks erhielten auch eine einfache Wendezugsteuerung, andere für bessere Streckensicht eine Kanzel auf dem Dach.
V60
V60 1255

Das Beschaffungsprogramm der DR für Dieseltriebfahrzeuge sah Anfang der
fünfziger Jahre für den Rangierdienst eine 600 PS starke
dieselhydraulische Lok vor. Das Einsatzgebiet sollte auch leichte Züge im
Streckendienst umfassen. Insbesondere die Ablösung der
Nebenbahntenderlokomotiven der Baureihen 89, 91 und 92 sollte durch diese
Maschine erfolgen.
Die dadurch gegebenen Bedingungen waren für die Konstruktion maßgebend. Im wesentlichen waren das die Achsfahrmasse von 15 t, eine Einmannbedienung mit gleich guter nach beiden Seiten, Befahrbarkeit von Ablaufbergen und sichere Aufnahme von Rangierpersonal an den Stirnseiten der Lok. 1959 wurde das erste Baumuster zur Erprobung fertiggestellt. Eine verbesserte Ausführung wurde mit der V 60 1201 als Baumuster 1964 vorgestellt.
Die Loks waren eine sehr erfolgreiche Konstruktion, die auch für viele Industriebahnen und ausländische Bahnverwaltungen gefertigt wurde. Die für die Loks nach 1970 vorgesehene EDV-Nummer 106 reichte 1975 mit Lok 999 nicht mehr aus, so dass die Baureihennummer 105 mit den nachfolgenden Maschinen belegt wurde.
Nach der Übernahme durch die DB AG verrichten diese Loks noch heute bundesweit bei diversen Privatbahnen Aufgaben im Transport- und Bahnbaudienst, beispielsweise bei der Pressnitztalbahn mit sitz im sächsischen Jöhstadt. auch als Museumsstück bleibt diese Maschine z.B. in der Ausführung des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde in Schwarzenberg der Nachwelt erhalten.
V75
T435 040
107 001



Für den mittleren und schweren Rangier- und Übergabedienst beschaffte die
deutsche Reichsbahn der DDR bei CKD dieselelektrische Maschinen, die sich
bereits bei der CSD bewährt hatten. In erster Linie arbeiteten sie in
Leipziger Bahnhöfen, schleppten aber auch Nahgüter- und Bauzüge. Außerhalb
der Heizperiode zeigten sie sich auch vor Reisezügen. Trotz guter
Leistungen trennte sich die DR schnell von den Maschinen, die technisch
nicht zum übrigen Fuhrpark passten. Mitte der achtziger Jahre waren alle
Lokomotiven abgestellt.
V100
V100 148
V100 098

Um die Lücke zwischen den Loks V60 und V180 zu schließen und damit die
teils noch von den Länderbahnen stammenden Dampfloks in diesem
Leistungsbereich abzulösen, wurde ab 1965 die 100 km/h schnelle V100
gebaute. Die Baumuster entstanden wie die V180 in Babelsberg. Die Serienlieferung
kam dann aber ab 1966 aus Hennigsdorf. Diese dieselhydraulische Lokomotive
erhielt für die Zugheizung einen Dampferzeuger. Zahlreiche Loks wurden
Mitte der siebziger Jahre mit leistungsstärkeren Motoren versehen bzw.
erhielten noch weitere technische Änderungen, äußerlich sichtbar z.B.
durch geänderte Luftansauggitter, Wegfall der Rahmenverkleidung oder
durch Einsatz Verschleißpufferbohle, woraus sich eine größere Länge
über Puffer ergab. Die leistungsstärkeren Maschinen wurden als BR 112
bezeichnet. Schwere Rangierloks der gleichen Konstruktion ohne
Streckengang und Zugheizung mit einer auf 70t erhöhten Dienstmasse und
auf 65 km/h reduzierten Geschwindigkeit wurden schließlich als BR 111
beschafft.
Die Dieselloks der V100 bewährten sich äußerst gut und fanden als Mehrzwecklokomotiven ein breites Anwendungsfeld. Sie verkehrten auf fast allen Nebenbahnstrecken der DR ebenso wie im Vorort-Verkehr von Großstädten. Neben dem Einsatz im Streckendienst zur Personen- und Güterbeförderung übernahmen diese Maschinen teils auch Rangieraufgaben, ebenso waren Sie in Doppeltraktion für den mittelschweren Transportdienst geeignet. Dieses vielfältige Aufgabengebiet setzte sich auch mit der Übernahme durch die DB AG fort. Auch bei privaten Bahngesellschaften ist diese Baureihe noch heute bundesweit im Einsatz.
Es befinden sich die oben abgebildeten Modelle in meinem Fuhrpark.
BR130
130 007-8

Aus den Betriebserfahrungen mit der Güterzuglokomotive V200 der DR wurde
im Lokomotivwerk Woroschilowgrad mit der DR eine leistungsstärkere
Lokomotive entwickelt. Die Lok der BR 130 mit dieselhydraulischer Kraftübertragung
waren bei der DR für den schweren Güterzug- und Reisezugdienst
vorgesehen. Die ersten Maschinen wurden 1970 noch ohne Zugheizanlage
ausgeliefert, Loks mit elektrischer Zugheizung wurden ab 1972 in Dienst
gestellt. 1973 wurden die Lokomotiven in 3 Unterbaureihen gegliedert. Die
oben dargestellte BR130 besaß kein Zugheizung und war bis 140 km/h
zugelassen, die Loks der Baureihe 131 waren nur bis 100 km/h zugelassen.
Die Maschinen der Baureihe 132 waren mit elektrischer Zugheizanlage
ausgerüstet und sie fuhren 120 km/h. Außerdem wurden ab 1977 noch 6
Lokomotive der Baureihe 142 mit leistungsstärkeren Motoren mit 4000 PS
beschafft. Damit waren sie die stärksten Loks der DR.
V180
V180 146
V180 018
V180 091
V180 028
V180 055




1955 wurde die erste Streckenlokomotive der DR als V180 geplant. 1963
begann die Serienlieferung als zweimotorige, vierachsige
dieselhydraulische Lokomotive. Um die Maschinen der Baureihe V180 auch auf
Nebenbahnstrecken einsetzen zu können, musste die Achsfahrmasse unter 16t
liegen. Dazu wurde die V180 mit neuen dreiachsigen Drehgestellen
ausgerüstet. 1966 begann die Auslieferung der sechsachsigen Variante, die
bis 1970 gebaut gebaut wurde und dann als BR 118.2 eingeordnet wurde. Ab
1972 wurden in die Lokomotiven stärkere Motoren mit 2400 PS eingebaut.
Dies ist an den Lüftungsgittern anstelle der äußeren Fenster zu
erkennen. Die Maschinen sind sehr zuverlässig und bis heute im Einsatz.
Als Zugheizanlage steht ein Dampferzeuger zur Verfügung. Die
Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h.
Meine Modelle sind Vierachsvarianten, die ich bei
gegebener Zeit umnummerieren werde.
Hinzugekommen ist die Startlok in weiß-blau.
V200 der DB
V200 027

Die Lokomotiven der Baureihe V200 stellen den Prototyp der europäischen
Diesellok mit hydraulischer Kraftübertragung dar. Nach Erprobung der
ersten einmotorigen V80 im Jahre 1952 wurden die für den F-Zug und
D-Zugeinsatz vorgesehenen ersten Baumuster der zweimotorigen V200 schon
1953 in Dienst gestellt. Die Serienfertigung begann schon 1955. Das oben
abgebildete Modell ist eines dieser Maschine. Sie besitzt aber eine
Sonderlackierung, die in einem Katalog von 1963 als Modell angeboten wird.
Passt dazu gibt es auch Reisezugwagen.
Das hohe Verkehrsaufkommen zu Beginn der sechziger Jahre forderte eine Verstärkung der Maschinen. So wurde von 1962 bis 1965 die leistungsstärkere V200.1 mit 2700 PS in Dienst gestellt.
V200 der DR
V200

NOHAB My
My 1125

Elektrolokomotiven
E11
E11 022

Nach Wiederaufnahme des elektrischen Betriebes, 1955, setzte die
Reichsbahn zunächst aufgearbeitete Vorkriegsmaschinen ein. Wegen der
Elektrifizierung weitere Strecken brauchte sie neue Lokomotiven. LEW
entwickelte auf der Basis des Fahrzeugteils für die PKP eine
Schnellzuglokomotive. Sie zeigten gute Laufeigenschaften und bewährten
sich bestens. In verschiedenen Städten schleppten sie im S-Bahndienst
Wendezüge. Nach der Wiedervereinigung dezimierte sich der Bestand
der technisch überholten Maschinen schnell. Die DB konnte Mitte der
Neunziger Jahre auf sie verzichten.
E42
E42 018
E42 035



Aus den Schnellzuglokomotiven der Reihe E11 leitete LEW eine
Güterzugvariante mit geänderte Getriebeübersetzung ab. Somit sank zwar die
Höchstgeschwindigkeit von 120 auf 100 km/h, die Anzugskraft stieg aber von
216 auf 245 kN. Die robust konstruierten Maschinen schleppten auf
praktisch allen Strecken der DDR Güterzüge mit bis zu 1900 t Masse. Nach
der deutschen Vereinigung und dem drastischen Verkehrsrückgang der
Reichsbahn gehörten sie zum Loküberhang. Dennoch dauerte es bis Ende der
neunziger Jahre, ehe die letzte Lokomotive ausgemustert wurde.
E94
E94 065


E94 069



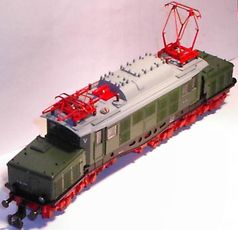

Die E94 ist die letzte im Auftrag der DRG gefertigte elektrische
Güterzuglokomotive. Sie war für den schweren Güterzugdienst und den
Betrieb an schwierigen Rampenstrecken vorgesehen. 1940 wurden die ersten
Maschinen bestellt. Auf Wunsch der Österreichischen Betriebsstellen wurde
eine elektrische Widerstandsbremse eingebaut. Da die Lok das vorgesehene
Leistungsprogramm sehr gut erfüllte, wurde sie auch während des zweiten
Weltkrieges weitergebaut. Auch nach dem Krieg lieferten BBC, Krupp und
Henschel noch einige Lokomotiven an die DB, WLF und Elin an die ÖBB. Die
E94 ist eine der gelungensten elektrischen Lokomotiven Deutschlands. 1995
kam das Aus bei der ÖBB, 1990 stellte die DR die letzten 2 Einheiten ab,
die DB 1988.
Triebwagen
VT 2.09. oder BR171
BR171 018
BR171 824

Die Beschaffung von Triebwagen für den kostengünstigen
Betrieb von Nebenbahnen geht bis vor die Jahrhundertwende zurück (damit
meine ich die Wende 19. und 20. Jahrhundert), die damals beschafften
Fahrzeuge der Länderbahnen waren meist mit Dampf betrieben. Aber auch
elektrische, aus Akkumulatoren gespeiste Triebwagen entstanden in dieser
Zeit. Die ersten Benzoltriebwagen hatten ebenfalls eine elektrischen
Kraftübertragung. Erst mit der Konstruktion geeigneter
Kraftübertragungselemente in Form von Strömungskupplungen und Getrieben
setzte in den dreißiger Jahren eine lebhafte Entwicklung
dieselhydraulischer Triebwagen ein. Die Entwicklungen wurden nach dem
Krieg wieder aufgenommen. Unter Berücksichtigung moderner
Produktionstechnologien und Leichtbautechniken entstand 1957 das erste
Baumuster des VT 2.09. im Waggonbau Bautzen. Die ersten Fahrzeuge der 1963
gebauten Serie hatten gebogene Seitenscheiben, die späteren Fahrzeuge
erhielten 3 kleinere Stirnfenster. Die 180 PS leistende Maschine mit
hydraulischer Kupplung und mechanischem Schaltgetriebe lässt eine
Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h zu. Die Fahrzeuge ab Baujahr 1964 haben
eine Mehrfachsteuerung, so dass auch von einem Steuerwagen aus bis zu zwei
Triebwagen gesteuert werden können. Dadurch entfiel die Notwendigkeit des
Umsetzens der Fahrzeuge am Endpunkt. Gleichzeitig wurden die
Scharfenbergkupplungen verstärkt. Damit kann ein Triebwagen zwei Beiwagen
ziehen. Es können somit zwei Einheiten von einem Steuer- oder Triebwagen
zusammenbetrieben werden, wobei eine Einheit aus einem Triebwagen + zwei
Beiwagen oder einem Triebwagen+ ein Beiwagen + ein Steuerwagen besteht.
Dadurch ist mit diesen Fahrzeugen auch der Übergang auf Hauptbahnen und
ein Vorortverkehr möglich.
Es gibt folgende Fahrzeuge: VT 2.09.003 bis 070 und VB 2.07.501 bis 570.
Wenn jemand Detailzeichnungen oder Bilder hat und sie mir zusendet, wäre ich sehr erfreut.
VT137
Personenwagen
Ci pr93

Ci30


Pwi 30

C3 pr11

Pw3 pr11

Rekowagen 4achsig

Doppelstockwagen

Y-Wagen



ABm

Pwgs-56

Güterwagen




















